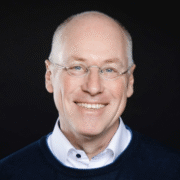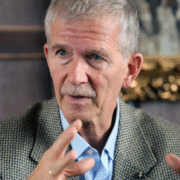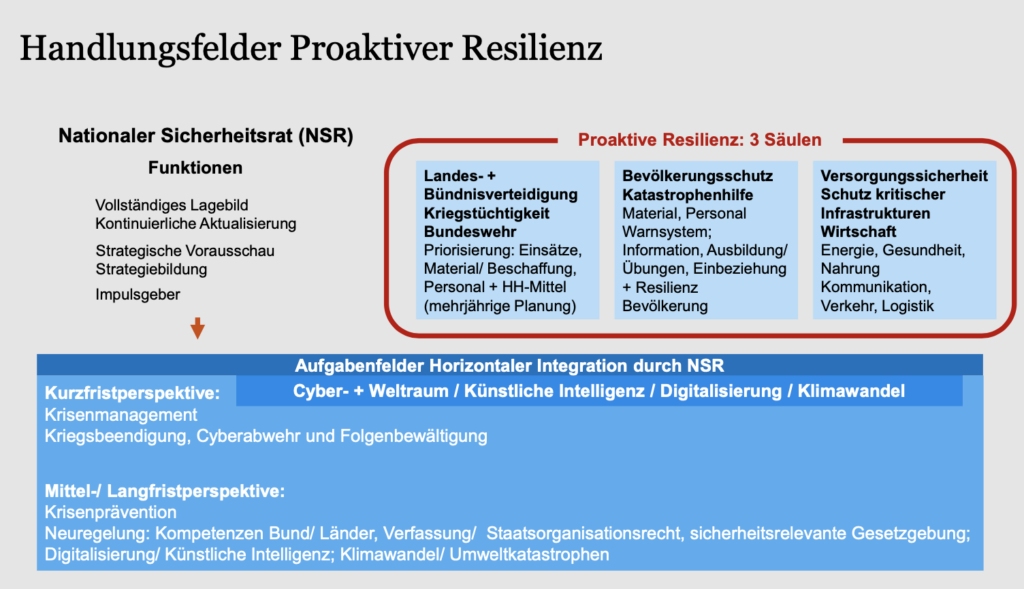Kein gerechter Friede ohne Zurückweisung des Aggressors
Ein Kommentar unseres Autors Dr. Klaus Olshausen
Ein analytischer Blick auf Europa und seine Partner zeigt geopolitisch, militärisch und ökonomisch äußerst gespannte Entwicklungen. Der brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine speist sich aus einem imperialistischen Machtanspruch des Kreml. Die europäischen Staaten und ihre Verbündeten in der Allianz wollen sich bis 2029 gegen ein zunehmend aggressives Russland wappnen. Doch sie zeigen weder den politischen Willen noch die strategische Entschlossenheit, Putins imperiales Ausgreifen bereits in der Ukraine entschlossen zurückzuweisen. Präsident Trump wiederum will diesen Krieg beenden – offenbar in der Einschätzung, dass die geopolitische Bedeutung gering sei. Der Schutz der Ukraine scheint für ihn weniger wichtig als mögliche neue wirtschaftliche Beziehungen zu Russland.
Dabei geht es für die Ukraine um weit mehr als nur territoriale Integrität und staatliche Souveränität. Sie kämpft um ihr Überleben als Nation, gegen die begonnene Russifizierung, gegen die Auslöschung ihres kulturellen Erbes und des gesellschaftlichen Lebens ihrer Bürgerinnen und Bürger. In dieser Lage entschloss sich Präsident Selenskyj – nach der öffentlichen Beschimpfung im Weißen Haus Ende Februar – zu zwei weitreichenden Schritten: Zum einen unterzeichnete er ein Abkommen, das den USA künftig erheblichen Zugriff auf die Ausbeutung ukrainischer Bodenschätze gewährt. Zum anderen stimmte er – gegen eigene politische und militärische Bedenken – Trumps Forderung nach einem bedingungslosen Waffenstillstand zu. Obwohl Putin auf Selenskyjs Angebot eines Treffens zur Beendigung des Krieges überhaupt nicht reagierte, folgte der ukrainische Präsident dennoch dem Druck der USA und nahm an zwei Gesprächsrunden mit russischer Delegation in Istanbul teil.
In diesen Wochen hat Putin seinen Krieg gegen die Ukraine weiter verschärft – militärisch an der Front und durch massive Luftangriffe auf zivile Ziele im Hinterland. Zugleich suggeriert er Verhandlungsbereitschaft, lässt jedoch inhaltlich keinerlei Zweifel daran, dass ein Waffenstillstand für ihn nur als Kapitulation der Ukraine denkbar ist. Die Europäer in NATO und EU wollen ihre Verteidigungsfähigkeit stark ausbauen, um so eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland zu erreichen. Anfang Juni haben die NATO-Verteidigungsminister mit Zustimmung der USA dazu weitreichende Beschlüsse gefasst. Die Unterstützung der Ukraine wird zwar fortgesetzt, aber nur in einem Maß, das den eigenen Fähigkeitsaufbau nicht wesentlich beeinträchtigt. Zudem planen die meisten Staaten, die Ukraine nach dem jetzigen Krieg so zu unterstützen, dass sie zukünftige Angriffe Russlands abschrecken kann – ein ambitionierter Plan, der auf der Hoffnung beruht, dass ein einmal errungener Friede auch stabil bleibt.
Das Institute for the Study of War (ISW) berichtet jedoch von russischen Kriegsplänen, die bis September 2025 die vollständige Einnahme aller vier bereits annektierten Oblaste zum Ziel haben und im Jahr 2026 die Kontrolle über die Hälfte der Ukraine bis zum Dnipro-Fluss sowie die Einnahme von Mykolajiw und Odessa vorsehen. Angesichts Russlands erklärter Strategie des „Sieges um jeden Preis“ erscheinen diese Pläne ohne anhaltende und massive westliche Unterstützung durchaus realistisch. Diese konkreten Etappenziele auf dem Weg zur vollständigen Unterwerfung der Ukraine müssten in den westlichen Hauptstädten endlich ernsthafte Überlegungen, klare Pläne und entschlossene Entscheidungen auslösen: Wie kann der Aggressor Russland nicht nur gestoppt, sondern sein imperiales Verhalten aktiv zurückgewiesen werden?
Bereits im vergangenen Juni hatte ich darauf hingewiesen, dass das Gedenken an den 80. Jahrestag des D-Day am 6. Juni 1944 keinerlei Impuls für ein „D-Day 2.0“ gegen einen neuen Aggressor erzeugt hat. Es war Bundeskanzler Merz, der im Weißen Haus daran erinnerte, dass Amerika einst einen Aggressor gestoppt und Deutschland vom Nazi-Regime befreit hatte – und damit indirekt forderte, dass auch Putin durch ein klares, gemeinsames Zeichen der USA und ihrer Verbündeten gestoppt werden müsse. Ich habe mehrfach betont, dass politische Risikovermeidung zur Zielverfehlung führt. Dass die massiv gesteigerten russischen Luftangriffe in den vergangenen zwei Monaten – während der Westen auf einen bedingungslosen Waffenstillstand drängte – nicht zu einer schnellen und umfassenden Verstärkung der Ukraine mit Flugabwehr, Präzisionswaffen und dringend benötigter Munition geführt haben, spielt Putins Verzögerungstaktiken in die Hände.
Die Verantwortung für die zahllosen Toten, Verwundeten und die systematische Zerstörung ukrainischer Infrastruktur liegt so nicht mehr allein bei Russland. Auch westliche Regierungen tragen Mitschuld, solange sie nicht bereit sind, ihre sicherheitspolitischen Versprechen in entschlossene Handlungen zu übersetzen. Von weiteren, scharfen Sanktionen ist derzeit keine Rede. Auch Präsident Trump hat sich bisher auf vage Andeutungen beschränkt. Der in letzter Zeit häufiger wiederholte Ruf – auch von Friedrich Merz – nach einem baldigen „Ende dieses abscheulichen Krieges“ läuft Gefahr, das Wesentliche zu verkennen: Ein bloßes Ende der Kampfhandlungen wird keine regelbasierte internationale Ordnung wiederherstellen. Ohne die klare Zurückweisung Putins wird er seine bisherigen Erfolge als Ausgangsbasis nutzen, um seine bekannten nächsten Ziele Schritt für Schritt zu verfolgen – gegen einen teilweise uneinigen und risikoscheuen Westen.
Warum fällt es so schwer, der eigenen Bevölkerung das Offensichtliche zu erklären – und entsprechend zu handeln? Eine heutige Anstrengung, den Aggressor Russland bereits in der Ukraine zurückzuweisen und so seine Offensivfähigkeit substanziell zu schwächen, würde der Allianz langfristig weniger abverlangen, als die Verteidigungsfähigkeit gegen einen durch Erfolge gestärkten Aggressor mühsam aufzubauen. Ein Ende des kinetischen Krieges, bei dem nicht die Selbstbestimmung der Ukraine und die Gleichheit aller Staaten als Prinzip verteidigt werden, bedeutet einen prekären Frieden. Denn der Wille und die gestärkte nationale Identität des ukrainischen Volkes werden sich einer aufgezwungenen Vereinbarung zugunsten des Aggressors dauerhaft widersetzen. Jeder Frieden, der nicht gerecht ist, ist nur der Auftakt zum nächsten Krieg.
Über den Autor: Generalleutnant a.D. Dr. Klaus Olshausen war von 2006 bis 2013 Präsident der Clausewitz-Gesellschaft. Zuvor war er Deutscher Militärischer Vertreter im Militärausschuss der NATO, bei der WEU und EU, HQ NATO, Brüssel. Dr. Olshausen gehört dem Fachbeirat des Sicherheitsforum Deutschland und ist Mitbegründer dieser Initiative.