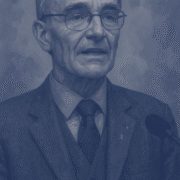In einem Interview, das Norbert Adam Froitzheim mit Michael Mertes führte, wird ein Phänomen analysiert, das im amerikanischen Kulturkampf eine wachsende Rolle spielt: den sogenannten Neokatholizismus. Dabei geht es nicht um eine neue Auslegung des römischen Glaubens, sondern um eine ideologisch aufgeladene, apokalyptisch grundierte Weltsicht, in der religiöse Symbole zur politischen Mobilisierung umgedeutet werden. Im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten wie Peter Thiel, J.D. Vance oder Steve Bannon – Männer, die sich selbst gern als Kämpfer gegen eine „woke Diktatur“ inszenieren. Wie ernst ist das alles zu nehmen? Und wie unterscheidet sich dieser neue Katholizismus von der Lehre Roms? Eine differenzierte Einordnung zwischen Theologie, Strategie und Kulturkampf.
Norbert Froitzheim: Wie definieren Sie den Begriff Neokatholizismus?
Michael Mertes: Der Begriff – oder, besser gesagt, das Etikett – „Neokatholizismus“ gehört zum Versuch, ein neues Phänomen semantisch einzuordnen. Ich weiß nicht, ob diese Bezeichnung sich auf Dauer halten wird. Das hängt letztlich vom Verfallsdatum der Ideologie ab, auf die das Wort sich bezieht.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Etikett „Neokatholizismus“ für eine intellektuelle Bewegung in Frankreich verwendet, die einen liberalen, die säkulare Moderne bejahenden Katholizismus anstrebte. Der heutige Neokatholizismus ist zwar auch eine intellektuelle Bewegung, aber er geht in die entgegengesetzte Richtung – er will nicht weniger, sondern mehr Transzendenz in der Politik.
Unter „Neokatholizismus“ heute verstehe ich eine kulturkämpferische Ideologie, die sich auf der Seite der Mächte des Lichts im Kampf gegen die Mächte der Finsternis wähnt. Die Mächte der Finsternis wollen, so glauben die Anhänger dieser Ideologie, eine „woke“ Gesinnungsdiktatur errichten. Sie streben einen totalitären Weltstaat an, der die Menschheit mithilfe KI-gestützter Überwachungstechnologie unter seine Kontrolle bringt.
Norbert Froitzheim: Und worin unterscheidet er sich der heutige Neokatholizismus vom traditionellen oder römischen Katholizismus?
Michael Mertes: Auf jeden Fall in seiner Haltung zum apokalyptischen Denken, aber auch in seiner Soziallehre. Damit sind wir beim Silicon-Valley-Milliardär Peter Thiel, der selbst zwar kein Katholik ist, aber doch ein einflussreicher Stichwortgeber des Neokatholizismus. Für Thiel, Unterstützer von Donald Trump seit 2016 und „Erfinder“ von Vizepräsident Vance, sind die Mächte der Finsternis, wie er sie sieht, identisch mit dem Antichrist, von dem das letzte Buch des Neuen Testaments, die Geheime Offenbarung, kündet. Der Antichrist tritt als Christus auf und verführt die verängstigte Menschheit mit dem Versprechen, unter seiner Herrschaft werde es Frieden und Sicherheit geben. Man könnte sich fragen, weshalb ausgerechnet der Mitgründer von „Palantir Technologies“ KI dämonisiert. Aber das ist nur scheinbar ein Widerspruch: Es kommt darauf an, wer über dieses Instrument verfügt – die Mächte des Lichts oder die Mächte der Finsternis. Thiel zufolge ist es bei Thiel in besten Händen.
Wer vom Neokatholizismus spricht, darf übrigens dessen geistige Verwandtschaft mit Teilen des evangelikalen Christentums in den USA nicht außer Acht lassen. Unter US-Evangelikalen ist die Erwartung einer baldigen Wiederkehr Christi – namentlich die Theologie des so genannten Dispensationalismus – sehr verbreitet. Apokalyptische Bewegungen, die den nahen Weltuntergang erwarten, sind in den USA allerdings nichts Neues; es gibt sie schon seit rund 200 Jahren. So originell Thiels eigenwillige Geschichtstheologie auch wirken mag – sie setzt in Wirklichkeit eine alte Tradition fort.
Mit dieser speziellen Tradition kann der traditionelle Katholizismus wenig anfangen. Rom hat zwar eine special relationship mit dem Teufel – der verstorbene Papst Franziskus hat oft vom Satan geredet –, und vor allem verkündet es unermüdlich die Hoffnung auf Wiederkehr Christi am Jüngsten Tag, aber im Vatikan stellt sich kein Schweizer Gardist darauf ein, dass demnächst die endzeitliche Schlacht von Harmagedon stattfinden und Christus sein Tausenjähriges Reich errichten wird. Rom geht auch nicht so nonchalant mit den Texten der Kirchenväter um, wie zum Beispiel Vizepräsident Vance es mit dem „Ordo amoris“ von Augustinus getan hat. Spätestens seit der Enzyklika „Quadragesimo anno“ von Papst Pius XI. hat die Katholische Kirche eine wohldurchdachte Soziallehre, die dem libertären Sozialdarwinismus mancher Trump-Oligarchen diametral widerspricht. Und schließlich: Der traditionelle Katholizismus hat sich längst von einer wörtlichen Interpretation der Heiligen Schrift gelöst; er ist, so gesehen, dezidiert nicht-fundamentalistisch.
Norbert Froitzheim: Ist das apokalyptische Denken denn spezifisch christlich?
Nein. In allen drei monotheistischen Weltreligionen haben sich messianische Vorstellungen vom Ende der Geschichte entwickelt. In muslimischen Gesellschaften des Nahen Ostens und Nordafrikas ist das 1987 publizierte Buch „Der Antichrist“ des ägyptischen Schriftstellers Sa’id Ayyub populär. Ayyub kombiniert darin Aussagen des Korans mit apokalyptischen Visionen jüdischer und christlicher Provenienz. Zwar lehnten maßgebende Korangelehrte seine geschichtstheologischen Spekulationen ab, doch das hat seiner Beliebtheit bei Teilen des muslimischen Fußvolks keinen Abbruch getan. Thiel ist gewissermaßen der christliche Bruder im Geiste des Muslims Ayyub.
Norbert Froitzheim: Gibt es so etwas wie ein neokatholisches Netzwerk in den Vereinigten Staaten?
Michael Mertes: Schwer zu sagen. Es fällt jedenfalls auf, dass zum Berater- und Unterstützerkreis Trumps eine Reihe von kulturkämpferischen Katholiken gehört – eine „antielitäre Elite“, wie diese Gruppe einmal treffend bezeichnet wurden. Da fällt mir an erster Stelle Steve Bannon ein. Dann natürlich Vizepräsident Vance; er wurde evangelisch getauft und erzogen, machte während seines Studiums eine „wütende atheistische Phase“ durch und konvertierte 2019 zum Katholizismus. Auch Außenminister Marco Rubio hat eine interessante Glaubensbiographie: Ursprünglich Katholik, wurde er Mormone und später Baptist. Inzwischen gehört er wieder der Katholischen Kirche an. Ich glaube, man tritt Vance und Rubio nicht zu nahe, wenn man sich fragt, ob ihr gegenwärtiges Credo auf Lebenszeit gilt.
Zu den Beratern und Unterstützern Trumps zählte bereits 2016 Peter Thiel. Thiel gehört zu den Bewunderern des katholischen Kulturphilosophen René Girard. Er stammt aus einem freikirchlichen Elternhaus und bezeichnet sich selbst als „somehow heterodox“, das heißt als Christ mit unkonventionellen Ansichten. Man könnte auch noch erwähnen, dass Mike Pence, Trumps erster Vizepräsident, in einem katholischen Elternhaus aufwuchs, evangelikaler Christ wurde und sich selbst als „evangelikalen Katholiken“ bezeichnet.
Norbert Froitzheim: Welche Rolle spielen neokatholische Strömungen im amerikanischen Katholizismus?
Michael Mertes: Ich würde das nicht überbewerten. Nach meinem Eindruck ist und bleibt der Neokatholizismus, wenn es sich dabei überhaupt um eine konsistente Ideologie handelt, eher ein Elitenprojekt. Übrigens sollte man Neokatholiken nicht mit katholischen Neokonservativen wie zum Beispiel Michael Novak verwechseln, die der Grand Old Party nahestanden und sich vermutlich mit Schaudern vom Trumpismus abgewandt hätten. In meinem Bücherregal steht Novaks Essay „Moral Clarity in the Nuclear Age“ von 1983, eine brillante Kritik am Hirtenbrief der US-amerikanischen Bischöfe über die moralische Verwerflichkeit nuklearer Abschreckung. Ein Mann wie Bannon boxt weit unter Novaks Gewichtsklasse.
Nach einer Studie des Pew Research Center von Anfang März 2025 sind die US-Katholiken in einer zentralen Frage der amerikanischen „Culture wars“, nämlich dem Verbot der Abtreibung, gar nicht so eindeutig festgelegt, wie es gelegentlich den Anschein hat: 59 Prozent sind der Meinung, dass Abtreibung erlaubt sein sollte, entweder in den meisten oder in allen Fällen; nur 13 Prozent meinen, dass sie unter allen Umständen verboten sein sollte. Natürlich gibt es Unterschiede je nach parteipolitischen Präferenzen: Unter den katholischen Anhängern der Demokraten sagen 78 Prozent, dass Abtreibung in den meisten oder allen Fällen erlaubt sein sollte; bei den katholischen Anhängern der Republikaner sind es deutlich weniger, aber immerhin noch 43 Prozent.
Norbert Froitzheim: Was verbindet Persönlichkeiten wie JD Vance und Peter Thiel mit einer Wiederbelebung religiöser Rhetorik im öffentlichen Raum?
Michael Mertes: Es ist wohl eine Mischung aus echter Überzeugung und politischer Strategie – wobei ich mir nicht anmaße zu sagen, welches dieser beiden Elemente dominiert. Bill Clinton wird oft zitiert mit dem Satz „It’s the economy, stupid!“ Der stimmt zwar nach wie vor – die Inflation in den USA war für viele Wähler ein Grund, Trump ihre Stimme zu geben –, aber der Mensch lebt nun einmal nicht vom Brot allein. Es gilt eben auch, und vielleicht mehr denn je: „It’s the culture, stupid!“ Wobei unter „culture“ im weitesten Sinne auch die Religion fällt.
Warum ist die Mehrheit der stimmberechtigten Katholiken bei der Präsidentschaftswahl 2024 von den Demokraten zu den Republikanern übergelaufen? 56 Prozent stimmten für Trump, von den Nachfahren europäischer Einwanderer sogar über 60 Prozent. Gut die Hälfte, 53 Prozent, der registrierten katholischen Wähler sind Anhänger der Republikaner, 43 Prozent neigen den Demokraten zu. Von den evangelikalen Wählern stimmten erwartungsgemäß rund 80 Prozent für Trump. Ich glaube nicht, dass diese Befunde allein mit der wirtschaftlichen Situation zu erklären ist.
Norbert Froitzheim: Was ist mit der Religiosität von Präsident Trump?
Michael Mertes: Die Religiosität von Trump ist wohl ein Fall für sich. Sein Biograph Michael Wolff hat kürzlich in einem Interview erklärt, er sei skeptisch, „wann immer Trump das Wort ‚Gott‘ gebraucht. Ich würde das nicht allzu ernst nehmen. Wenn es in der Trump-Welt einen Gott gibt, stünde der an zweiter und Donald Trump an erster Stelle.“ Was Trump gewiss mehr interessiert als Theologie, ist die Frage, wer ihn wählt und wie er diese Wählergruppen ansprechen kann. Er wird ja von vielen seiner evangelikalen Anhänger als Messias verehrt. Das ist keine Frage seines persönlichen Lebenswandels, und es ist durchaus nicht unbiblisch: Der persische Großkönig Kyros II., ein Heide, wird beim Propheten Jesaja als Messias gefeiert, weil er als Werkzeug Gottes die Babylonier besiegte und das jüdische Exil beendete. Trumps persönliche Moral interessiert nicht, solange er im Auftrag Gottes das amerikanische Volk aus der babylonischen Gefangenschaft des Wokismus befreit.
Norbert Froitzheim: Gibt es da einen Zusammenhang mit der neuen Außenpolitik Washingtons?
Michael Mertes: Ja, vor allem in Bezug auf die UNO und die Europäische Union. Wenn wir von der Vorstellung ausgehen, dass sich die Welt in einem apokalyptischen Endkampf zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der Finsternis befindet, dann sind alle Organisationen, die angeblich am Aufbau eines antichristlich-totalitären Weltstaats mitwirken, als Feinde zu betrachten. Für die Vereinten Nationen gilt das allemal, aber auch für multilaterale Institutionen wie den Internationalen Strafgerichtshof, denen nachgesagt wird, sie wollten die USA in Fesseln legen. Es gilt nicht zuletzt für die Europäische Union, die mit ihrem supranational-säkularen Selbstverständnis zu den Wegbereitern eines künftigen Weltstaats gehören soll.
Während seiner Rede am 14. Februar 2025 bei der Münchner Sicherheitskonferenz schockierte Vance sein Publikum mit den Sätzen: „Die Bedrohung, die mich in Bezug auf Europa … am meisten besorgt, ist nicht Russland, nicht China, nicht irgendein anderer externer Akteur. Was mich besorgt, ist die Bedrohung von innen. Der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte, Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt.“ Ich lese das so, dass der Neokatholizismus den Westen nicht mehr als Einheit betrachtet, sondern als gespalten zwischen Gut und Böse. Über Putin mag man sagen, was man will – aber er kämpft doch einen guten Kampf gegen die Dämonen von LGBTQ & Co., nicht wahr?
Norbert Froitzheim: Sie sehen also in dieser Betrachtungsweise das Hauptproblem für den Zusammenhalt des Westens?
Michael Mertes: Nein, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich bin sehr dafür, dass man bei der Fehlersuche nicht einseitig vorgeht. Jeder fasse sich an seine eigene Nase. Linke, minderheitsbezogene Identitätspolitik hat zur Polarisierung der US-Gesellschaft nicht weniger beigetraten als rechte, mehrheitsbezogene Identitätspolitik. Wie es aussieht, haben beide einander hochgeschaukelt. Beide haben ein eigenes Opfernarrativ entwickelt. Daraus entsteht ein binärer Code, der die gesellschaftliche Wirklichkeit im Licht manichäischer Unterscheidungen wie Gut und Böse, Täter und Opfer, Freund und Feind, Christ und Antichrist, Gott und Satan interpretiert. Zwischen Feuer und Wasser gibt es nun einmal keinen Kompromiss, es gibt nur noch „wir“ oder „die“, Sieg oder Niederlage. Das nenne ich das Paradox der Moralisierung: Sie führt zu höchst unmoralischen Ergebnissen. Und sie macht blind für eigenes Versagen: „Cancel culture“, das machen ja immer nur die anderen.
Das größte Problem linker Identitätspolitiker scheint mir zu sein, dass sie auf die „Hillbillies“, die weißen Unterschichtler und Hinterwäldler verächtlich herabschauen, sie nicht ernst nehmen. Unvergessen ist die Verhöhnung dieser „deplorables“, dieser jämmerlichen Typen, durch Hillary Clinton 2016. Eine solche Haltung nennt man heute „Klassismus“. Die Hillbillies schlugen zurück, angeführt von Leuten proletarischer Herkunft wie Bannon oder Vance oder proletenhaft auftretenden Personen wie Trump. In Polen haben wir erst jüngst ein ähnliches Phänomen erlebt, als der soziale Aufsteiger Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewann: Der Versuch, ihn „als Jungen aus der Gosse bloßzustellen, erzielte gerade in den entscheidenden zwei Wochen zwischen den beiden Urnengängen einen gegenteiligen Effekt“ – so der Historiker Felix Ackermann.
Norbert Froitzheim: Stichwort „Opfernarrativ“: René Girard sah im Christentum eine einzigartige Offenlegung und Überwindung des Opfermechanismus – wie prägt dieses Verständnis von Schuld, Sühne und Gewalt die neokatholische Weltanschauung von Thiel und Vance, und inwiefern wird dabei Christus als Ende aller Opfer tatsächlich ernst genommen?
Michael Mertes: Man sollte zwischen der Opfertheorie von René Girard und ihrer kreativen Adaption durch Peter Thiel klar unterscheiden. Thiel formuliert Girards Theorie für seine Bedürfnisse um. Er sieht sich selbst als „Contrarian“, als Nonkonformisten, der die Wut der konformistischen, Status-quo-fixierten Meute auf sich zieht. Dieser Mob macht ihn und andere Nonkonformisten zu Sündenböcken im biblischen Sinne – also zu Opfertieren, auf die man eigene Schuld ablädt. Es hat schon etwas Drolliges, wenn eine Person von exorbitantem Reichtum und gewaltigem politischen Einfluss sich selbst als Opfer darstellt.
Ihre Frage, ob eine solche Sichtweise Christus tatsächlich ernst nimmt, ist völlig berechtigt. Ehrlich gesagt, mir kommt die Thiel’sche Opfertheorie blasphemisch vor. Thiel ist kein Märtyrer, beim besten Willen nicht; niemand will ihn kreuzigen. Schon die Opfertheorie Girards halte ich für eine problematische Deutung des Kreuzestodes Jesu. Das Konzil von Nizäa hat vor 1700 Jahren eine andere, eine tragfähigere Interpretation in den Rang eines Glaubenssatzes erhoben: Im Sohn wollte der Unbegreifliche sich begreiflich machen, der Leidensunfähige ein leidensfähiger Mensch werden, der Unsterbliche sich den Gesetzen des Todes unterwerfen – so hat es Papst Leo der Große im Jahr 449 n. Chr. ganz wunderbar formuliert.
Norbert Froitzheim: Ist die Berufung auf Girard theologisch fundiert oder eher selektiv – etwa als Mittel zur Sinnstiftung in einer postliberalen Welt?
Michael Mertes: Ob die Berufung auf Girard theologisch fundiert ist, müssen Leute vom Fach, also Theologen, beurteilen. Als theologischer Laie habe ich da meine Zweifel. Dass Thiel sich als Sinnstifter sieht, als Prophet in einer postliberalen Welt, halte ich für durchaus plausibel. Mir kommt er wie ein Guru vor – und bei solchen Leuten denke ich unwillkürlich an die Warnungen im Neuen Testament vor den falschen Propheten. Das heißt keineswegs, dass ich ihn nicht ernst nehme; er kann viel Schaden anrichten. Andererseits denke ich, dass seine Ideologie so elitär, so esoterisch und, ja, so verschwurbelt ist, dass sie keine Breitenwirkung entfalten wird.
Norbert Froitzheim: Inwiefern könnte man Peter Thiel als einen „konstantinischen Denker“ bezeichnen – also als jemanden, der religiöse Ordnung zur Stabilisierung weltlicher Macht sucht?
Michael Mertes: Ich nehme an, sie beziehen sich auf das Thiel zugeschriebene Zitat „Ich persönlich habe immer das Christentum von Kaiser Konstantin demjenigen von Mutter Teresa vorgezogen.“ Über die Motive Thiels weiß ich ebenso wenig wie über den Glauben von Vance, Rubio oder Trump – ich kann nicht in sein Herz schauen. Ich kann nur feststellen, dass er sich eine Ideologie zurechtgezimmert hat, die im Ergebnis der Stabilisierung, aber auch der Zerstörung weltlicher Macht dient. Vor allem dient sie der Legitimation von Monopolen – in dieser Hinsicht widerspricht sie diametral der Philosophie des Liberalismus, die den Wert des Wettbewerbs betont. Gut ist für ihn die Macht, die den Kindern des Lichts dient, schlecht die Macht, die den Kindern der Finsternis hilft. Auf diese simple Schlussfolgerung scheint mir sein ganzes Evangelium hinauszulaufen.
Norbert Froitzheim: Sehen Sie in der politischen Aktivität der neokatholischen Akteure eine Art modernes Konzil von Nicäa – ein Versuch, religiöse Einheit zu schaffen, um eine neue politische Ordnung zu begründen?
Michael Mertes: Ich glaube nicht, dass man hier Parallelen ziehen kann. Im Jahr 325 n. Chr. ging es Kaiser Konstantin darum, Einigkeit in einem erbitterten theologischen Streit herbeizuführen, der die damalige Christenheit spaltete. Streitgegenstand war, kurz gesagt, die Frage nach der „Wesensgleichheit“ zwischen dem Vater, dem Schöpfer, und dem Sohn Jesus Christus. Die so genannten Arianer vertraten die Ansicht, Christus sei nur das höchste Geschöpf Gottes, also nicht göttlicher Natur. Vor 1700 Jahren setzte sich die Gegenposition durch, die das christliche Glaubensbekenntnis bis heute bestimmt.
Da das Christentum zu Beginn des 4. Jahrhunderts immer mehr Zulauf hatte, war der damalige Streit schlecht für die Reichseinheit. Dass Konstantin selbst die Sache pragmatisch sah, zeigt sich daran, dass er sich auf dem Sterbebett arianisch taufen ließ. Seine Position beim Konzil von Nicäa könnte man salopp so zusammenfassen: „Mir ist egal, worauf ihr euch einigt, nur einigen müsst ihr euch!“
Norbert Froitzheim: Inwieweit lässt sich die heutige Konvergenz von konservativer Politik und Neokatholizismus mit Konstantins strategischer Christianisierung des Römischen Reiches vergleichen?
Michael Mertes: Zunächst würde ich bestreiten, dass es eine Konvergenz von konservativer Politik und Neokatholizismus gibt. Das Gegenteil von „konservativ“ ist „disruptiv“, und der Neokatholizismus, wie ich ihn sehe, ist eine zutiefst disruptive, um nicht zu sagen revolutionäre Ideologie, die einen Aufstand gegen den angeblich von den Mächten der Finsternis dominierten Status quo propagiert.
Kaiser Konstantin war sicher kein aktiver Christianisierer, sondern ein machpolitischer Realist und Pragmatiker, der einfach zur Kenntnis nahm, dass der christliche Glaube sich im Römischen Reich trotz massiver Verfolgungen immer weiter verbreitete. Daraus zog er seine Schlüsse. Kaiser Julian, einer seiner Nachfolger (360 bis 363 n. Chr.), versuchte, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, jedoch ohne Erfolg. Unter Kaiser Theodosius dem Großen wurde das Christentum 380 n. Chr. schließlich Reichsreligion – nicht schon unter Konstantin, wie man oft hört.
Norbert Froitzheim: Ist der Rückgriff auf katholische Traditionen nur ein Gegenentwurf zur liberalen Moderne – oder ein Versuch, neue imperiale Narrative zu schaffen?
Michael Mertes: Ersteres wohl ja, Letzteres nein. Der „America first“-Isolationismus eines Donald Trump ist gerade nicht imperial, sondern nationalistisch. Er ist eine Absage an den „liberalen Interventionismus“ (Timothy Garton Ash) früherer Zeiten und folgt dem Motto von Schillers Wilhelm Tell: „Der Starke ist am mächtigsten allein.“ Nach meiner Überzeugung ist das ein historischer Irrtum, der Amerikas Gewicht in der Welt nicht vergrößern, sondern verkleinern wird. Das amerikanische Imperium des 20. Jahrhunderts war ein „Empire by Invitation“ mit den USA als wohlwollendem Hegemon. Von Einladung und Wohlwollen ist unter Trump nichts mehr zu spüren, und Amerikas soft power schmilzt infolgedessen wie Schnee in der Sonne.
Was den ersten Punkt anbetrifft, so muss ich die katholische Tradition in Schutz nehmen gegen den pauschalen Verdacht, sie sei unvereinbar mit der liberalen Moderne. Ich bin sehr gespannt, wie der neue Papst Leo XIV. sich in dieser Hinsicht positionieren wird. Nach meinem Eindruck passt er in keine Schublade. Er kennt seine amerikanischen Pappenheimer und hat das intellektuelle Kaliber, theologischen Selfmademen wie Thiel Paroli zu bieten. Mit dem Tod von Papst Franziskus haben die amerikanischen Neokatholiken einen Erzfeind verloren. Darüber mögen sie sich klammheimlich gefreut haben, aber sie könnten bald merken, dass es ein Pyrrhussieg war.
Norbert Froitzheim: Herr Mertes, ich bedanke mich für das Gespräch.
Michael Mertes, geb. 1953, ist Jurist. Er arbeitet heute als Autor und literarischer Übersetzer. Bis 1998 war er im Bundesdienst tätig, zuletzt als Ministerialdirektor im Bundeskanzleramt. Von 2006 bis 2010 vertrat er als Staatssekretär das Land NRW beim Bund und bei der EU. Von 2011 bis 2014 leitete er das Auslandsbüro Israel der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jerusalem.
Norbert Adam Froitzheim ist 1. Vorsitzender des Sicherheitsforum Deutschland.
Bild: Michael Mertes