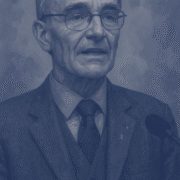Platzpatrone? Der neue Wehrdienst – Kabinett will ein kräftiges Zeichen setzen

Ein Kommentar von Norbert Adam Froitzheim
Das Kabinett hat am 27. August 2025 beschlossen, ein Gesetz für die Einführung eines neuen Wehrdienstes ab 2026 einzuführen, der zunächst eine Freiwilligkeit vorsieht und mit höheren Soldzahlungen und eine verpflichtenden Musterung ab 2027 beinhaltet. „Sicherheit steht in der Agenda weit oben“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es sei aber auch ein „starkes Signal aus Berlin an die europäischen Verbündeten, dass Deutschland ein handlungsfähiger Partner in der Nato ist“. Russland sei und bleibe eine Bedrohung.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ergänzte: „Es ist nicht irgendein Gesetz, es ist ein Riesen-Schritt nach vorne. Es muss nachhaltig und langfristig sein. Das Mindset bei jungen Männern und Frauen soll sich ändern.“ Und junge Männer und Frauen müssten sich entscheiden: „Ist mir das egal? Will ich Verantwortung übernehmen? Und wenn ja, an welcher Stelle?“
Die Bundeswehr benötigt etwa 80.000 zusätzliche aktive Soldaten. Aus den Ableitung der Natoziele ergibt sich nämlich für Deutschland eine Größenordnung von 260.000 Männern und Frauen in der stehenden Truppe, um einem potenziellen Angriff etwa Russlands auf Nato-Gebiet standzuhalten.
Unabhängig davon, dass hier ein Kompromiss als Lösung verkauft wird und es für viele Fachleute dringend geboten gewesen wäre, den Wehrdienst in seiner früheren Form wieder einzuführen, lohnt sich vielleicht ein Blick auf das, um was es wirklich geht. Darum zunächst einmal die Frage, was man mit einem Wehrdienst überhaupt bezwecken möchte. Es geht nämlich nicht darum, jungen Menschen in einer wichtigen Phase ihres Lebens die Zeit zu stehlen, sondern aus dem Pool der Wehrdienstleistenden Zeitsoldaten und Reservisten zu rekrutieren. Wenn die Bundeswehr also 80.000 zusätzliche aktive Soldaten braucht, dann stellt sich zunächst einmal die Frage, bis wann diese Soldaten denn fertig ausgebildet, ausgestattet und einsatzfähig sein sollen. Mit Blick des Kanzlers auf eine potenzielle russische Bedrohung bleiben wir im Ungefähren, wann diese Bedrohung denn real sein wird. Folgt man verschiedenen Spekulationen, dann könnte dies 2029 der Fall sein. Dies natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Russland nicht früher auf die Idee kommen könnte, Narwa in Estland zu attackieren und damit nach Artikel 5 Natovertrag den Bündnisfall auszulösen. Da wäre nämlich möglicherweise so: Estland ruft Artikel 4, der Nordatlantikrat tritt zusammen und jedes NATO-Land entscheidet, wie es den Bündnisfall konkret unterstützt.
Ungeachtet der Frage, ob es dann tatsächlich zu diesem Bündnisfall käme, müsste sich eine ordentliche Ressourcenplanung mindestens auf 2029, wenn nicht auf 2027 einrichten. Es stellt sich dann allerdings die Frage, wie – und sieht man von einer Generalmobilmachung ab – man bis zu diesen Zeitpunkt auf die Zahl von 80.000 neuen Soldaten kommen will. Wie viele junge Menschen müsste Deutschland einziehen, um 80.000 Zeitsoldaten auszubilden?
Zunächst die Basiszahlen: In Deutschland leben derzeit etwa 3,25 Millionen Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Geht man davon aus, dass die ersten Jahrgänge ab 2026 eingezogen werden und bis 2030 fünf komplette Kohorten durchlaufen, ergibt sich die notwendige Grundgesamtheit an Rekruten.
Die entscheidende Variable ist die Konversionsrate. Eine Modellrechnung könnte wie folgt aussehen. So könnte erfahrungsgemäß etwa die Hälfte aller Wehrdienstleistenden den Dienst innerhalb des ersten Jahres abbrechen. Von den Verbleibenden entscheidet sich wiederum nur ein Teil für den Weg in die längerfristige Verpflichtung als Zeitsoldat („Conversion rate“). Historische Erfahrungswerte schwanken zwischen 10 und 25 Prozent, bei entsprechender Incentivierung vielleicht höher.
Nimmt man als mittlere Annahme eine Quote von 20 Prozent, bedeutet dies: Von allen Einrückenden werden im Ergebnis nur rund 10 Prozent Zeitsoldaten (50 Prozent Durchhalten × 20 Prozent Konversion). Um also 80.000 Zeitsoldaten zu gewinnen, müssten insgesamt etwa 800.000 junge Menschen zwischen 2026 und 2030 einrücken, also rund 160.000 pro Jahr. Das entspräche knapp fünf Prozent der gesamten 18- bis 25-Jährigen oder nahezu 40 Prozent eines einzelnen Jahrgangs.
Je nach angenommener Quote verändert sich das Bild erheblich:
- Bei nur 15 Prozent Konversion der Nichtabbrecher wären mehr als eine Million Einberufene nötig, also über 200.000 pro Jahr.
- Bei 25 Prozent Konversion ließe sich das Ziel bereits mit rund 640.000 Einrückenden erreichen, also etwa 128.000 pro Jahr.
Die Spannbreite zeigt: Selbst unter optimistischen Annahmen müssten sich jährlich eine sechsstellige Zahl junger Männer und Frauen freiwillig zum Wehrdienst verpflichten, um das Ziel von 80.000 Zeitsoldaten bis 2031 zu erreichen. Das erscheint utopisch. Es ist zu befürchten, dass unsere Verbündeten in der Nato und auch unsere amerikanischen Freunde anders als wir selbst den Grundrechenarten mächtig sind. Es bleibt deswegen zu hoffen, dass man dem „starken Zeichen“, das Kanzler Merz an die anderen Nationen senden will, nicht so richtig ernst nehmen. Im Kreml wird der Schrecken über die Ankündigung der Regierung sicherlich in Grenzen halten.
Und wenn Verteidigungsminister Pistorius sagt, dass sich „das Mindset bei jungen Männern und Frauen ändern soll“, dann scheint es dringend geboten, dass sich das Mindset erst einmal bei Minister Pistorius und seiner Partei ändern sollte. Einige Unionsabgeordnete wissen es ohnehin: Mit einem Ackergaul ist das Grand National nicht zu gewinnen. Eine gute Portion Pragmatismus und Realismus würde in Berlin für frische Luft sorgen.
Norbert Adam Froitzheim ist 1. Vorsitzender des Sicherheitsforum Deutschland e.V.