Ein Kommentar von unserem Autor Rolf Clement
Es war ein „Running Gag“ in der Kanzlerzeit von Helmut Kohl. Bei den Pressekonferenzen zum Haushalt wurde er regelmäßig auch nach dem Verteidigungshaushalt gefragt – in Zeiten der Blockkonfrontation verlief die Diskussion um diesen Einzelplan ähnlich wie heute. Kohls Antwort war stets: „Die Bundeswehr bekommt, was sie braucht.“
Da jedoch die Ansätze im Einzelplan 14, dem Wehretat, damals deutlich hinter dem zurückblieben, was Experten für nötig hielten, machte bald ein ironischer Spruch die Runde unter Journalisten: Die Bundeswehr braucht, was sie bekommt.
Das hat sich nun geändert.
Die Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse – für die Sicherheit de facto ausgesetzt – macht die Koalitionsverhandlungen zielorientierter. Die Aussage „Das können wir uns nicht leisten“ fällt weg. Die Koalitionäre müssen nun festlegen, was für die Sicherheit Deutschlands nötig ist. Darüber muss dann der Bundestag beraten und entscheiden.
Denn es gilt weiterhin: Jedes Gerät, das die Bundeswehr beschafft und dessen Wert eine bestimmte Schwelle überschreitet, muss vom Haushaltsausschuss – nach entsprechender Beratung im Verteidigungsausschuss – gebilligt werden. Derzeit liegt diese Grenze bei 25 Millionen Euro. Sie müsste angehoben werden. Denn diese Schwelle führt dazu, dass das Verteidigungsministerium kaum noch etwas ohne Bundestagsbeteiligung beschaffen, nachbeschaffen oder ersetzen kann. Das wäre ein erster Schritt zum Bürokratieabbau.
Schaut man zunächst nur auf die Bundeswehr, ist der Mangel dort bekanntlich groß.
Die Bundeswehr strebt eine Vollausrüstung für zwei Brigaden an: eine nationale Brigade im Rahmen der Division 2025 und die in Litauen stationierte. Um dieses Ziel zu erreichen, wird bereits Gerät zusammengezogen. Hinzu kommt, dass die Bundeswehr viel Material an die Ukraine abgegeben hat. So ist im deutschen Anteil der deutsch-französischen Brigade kaum noch eine Ausbildung am Gerät möglich – es fehlt schlicht an Ausrüstung.
Die erste Aufgabe des neuen Bundestages wird es also sein, die entstandenen Lücken zu schließen, damit die Soldatinnen und Soldaten angemessen ausgebildet werden können.
Der zweite Schritt ist ein Plan, was die Bundeswehr künftig in welchem Umfang braucht.
Die Auseinandersetzungen der letzten Jahre – Bergkarabach 2020, Ukraine seit 2022 – haben neue Entwicklungen offengelegt. In beiden Konflikten haben Drohnen eine überragende Bedeutung gewonnen. Viele Operationen werden durch Drohnen geführt.
Vor diesem Hintergrund mutet die frühere deutsche Debatte darüber, ob Drohnen bewaffnet werden dürfen, geradezu weltfremd an. Diese Diskussion scheint nun beendet: Drohnen ohne Waffen haben im Gefecht wenig Wirkung.
Das zeigt: Kriegerische Auseinandersetzungen werden heute mit deutlich vielseitigeren Mitteln geführt.
Natürlich bleibt die Panzerwaffe ein zentrales System. Man erinnere sich an den Beginn des Ukraine-Kriegs, als Russland mit einer massiven Panzerkolonne versuchte, schnell Kiew zu erreichen. Diese Kolonne wurde durch gezielte Angriffe der Ukrainer zum Erliegen gebracht. Einige Panzer wurden so zerstört, dass nachfolgende Fahrzeuge blockiert wurden. Dieses Vorgehen kann nicht verallgemeinert werden, doch es zeigt die Verwundbarkeit. Die Panzerwaffe bleibt Teil des Kriegsgeschehens – wie andere Waffensysteme auch.
Immens wichtig sind Aufklärungsmittel.
Die Diskussion darüber, ob die USA ihre Aufklärungsdaten der Ukraine weitergeben, muss Europas Staaten auf den Plan rufen. Sie können sich nicht mehr bedingungslos darauf verlassen, dass Washington bei Bedarf liefert. Auch hier muss der neue Bundestag investieren.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherung der Infrastruktur.
Diese Aufgabe wird aus dem regulären Haushalt und dem Sondervermögen finanziert. Zwei Beispiele:
-
Die Sicherheit der Verkehrswege in der Ostsee ist zunehmend bedroht. Dort operieren Schiffe mit verdecktem militärischem Auftrag, beschädigen Unterseekabel – die Lebensadern der digitalen Kommunikation – und umgehen Sanktionen gegen Russland. Russisches Öl wird auf hoher See illegal umgeschlagen. Die Marine muss in die Lage versetzt werden, solche Vorgänge aufzudecken und zu unterbinden. Dies wird auch über einen Waffenstillstand hinaus erforderlich sein – hybride Kriegsführung wird weitergehen, auch im scheinbaren Frieden.
-
Deutschland ist im Krisen- und Kriegsfall eine logistische Drehscheibe für die NATO. Truppenbewegungen unserer Verbündeten werden über deutsches Gebiet laufen. Dafür müssen Straßen und Brücken belastbar sein – nicht nur Autobahnen und Bahntrassen, sondern auch Ersatzrouten. Hauptverbindungen würden im Ernstfall schnell Ziel gegnerischer Angriffe.
Auch jenseits offener Kampfhandlungen sind Deutschland und seine Bündnispartner bereits Ziel hybrider Angriffe.
Diese Angriffe finden jetzt schon statt. Die Gegenmaßnahmen müssen massiv ausgeweitet werden. Dabei sind auch offensive Optionen zu prüfen: Es kann nicht sein, dass Russland und seine Verbündeten unsere Informationskanäle fluten, während wir das nur freundlich abwehren.
Der Westen muss um die Informationshoheit auch offensiv ringen – mit digitalen Mitteln. Hier wartet auf die neue Bundesregierung und den Bundestag eine zentrale Aufgabe.
Ein weiterer Bereich ist die Luftverteidigung.
Auf NATO-Ebene wird an einem gemeinsamen System gearbeitet. Diese Bemühungen müssen intensiviert und beschleunigt werden.
Dazu gehört auch die Fähigkeit, gegnerische Angriffe durch Maßnahmen im gegnerischen Hinterland zu unterbinden.
Vor diesem Hintergrund ist die deutsche Debatte über die Lieferung von Taurus-Systemen unverständlich. Selbstverständlich muss die NATO über solche Fähigkeiten verfügen – und sie auch nutzen.
Zugleich muss die europäische Rüstungsautonomie gestärkt werden.
Die Abhängigkeit von den USA soll reduziert werden – nicht aus Misstrauen, sondern aus Realismus. Präsident Trump macht klar, dass seine Prioritäten nicht in Europa liegen. Aber auch unter einer Präsidentin Kamala Harris oder einem anderen demokratischen Nachfolger wird der sicherheitspolitische Fokus auf Asien liegen. Das ist nachvollziehbar, aber Europa muss selbst handeln.
Daher müssen europäische Projekte wie ein neues Heeressystem oder ein gemeinsames Transportflugzeug (Future Large Aircraft) mit Hochdruck vorangetrieben werden.
Deutschland hat vorerst US-Kampfjets beschafft – eine Entscheidung, die bereits beim Zustandekommen kritisch diskutiert wurde. Heute sind die Argumente der Kritiker noch plausibler geworden.
Die deutschen Rüstungsanstrengungen müssen mit denen der europäischen Partner harmonisiert werden.
Die EU hat ein milliardenschweres Programm zur Unterstützung der Verteidigung aufgelegt – vor allem für weniger finanzstarke Staaten. Diese Chance muss genutzt werden, um Planungen zu koordinieren.
Wann kommt es in der EU endlich zu echter Arbeitsteilung? Braucht jede Armee wirklich jede Fähigkeit im eigenen Land? Vieles ließe sich gemeinsam entwickeln.
Das aber setzt voraus, dass im Ernstfall gemeinsam entwickelte Rüstungsgüter allen Beteiligten zur Verfügung stehen.
Das läuft auf eine europäische Verteidigungsgemeinschaft hinaus – ähnlich dem Konzept der 1950er-Jahre, das damals am französischen Parlament scheiterte. Dabei ist auch zu prüfen, ob die EU der richtige Rahmen ist. Möglicherweise braucht es eine neue Bündnisstruktur – ohne etwa Ungarn, aber mit Großbritannien.
Und: Deutschland muss bei der Beschaffung schneller werden.
Die Industrie braucht klare Signale, damit sich Investitionen in Produktionskapazitäten lohnen. Sonst wird nicht geliefert.
Erste Fortschritte sind gemacht. Rüstungsunternehmen berichten von deutlich beschleunigten Abläufen. Verzögerungen entstehen inzwischen vor allem auf Seiten der Bundeswehr – bei Entscheidungsfindung und Erprobung. Hier muss die Regierung entschlossen gegensteuern.
Bei all dem geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Menschen.
Die Bundeswehr versucht seit Jahren, die Personalstärke von 180.000 auf 203.000 zu erhöhen. Diese Zahl dürfte künftig noch zu niedrig sein.
Die Wiedereinführung einer allgemeinen Dienstpflicht wird diskutiert – zu Recht. Doch allein darauf zu setzen, wäre naiv.
Die demografische Entwicklung spricht dagegen: Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre gehen in den Ruhestand, die nachrückenden Jahrgänge sind deutlich schwächer.
Deshalb muss klug geplant werden – für alle Organisationen: Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienste, Feuerwehren.
Fazit:
Die Debatte um eine Grundgesetzänderung hat gezeigt, dass es um zentrale Fragen deutscher Politik geht.
Geld allein reicht nicht. In den vergangenen Jahren ist ein erheblicher Handlungsstau entstanden. Jetzt muss entschlossen gehandelt werden – mit den bereitgestellten Mitteln, aber auch mit einem klaren sicherheitspolitischen Kompass.
Dafür braucht die Bundesregierung – und die sie tragende Koalition – einen neuen Mindset in der Bevölkerung.
Diesen wollte Bundeskanzler Scholz mit seiner „Zeitenwende“-Rede nach dem russischen Überfall auf die Ukraine anstoßen.
Doch außer der Rede folgte wenig. Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist da – es muss nun gestärkt und stabilisiert werden.
Bislang hat der Bundestag vor allem finanzielle Mittel bereitgestellt. Doch das Sondervermögen für die Bundeswehr ist im Grundgesetz verankert – es gilt auch in künftigen Legislaturperioden.
Das erhöht die Verantwortung. Nun braucht es gute Begründungen und kluge Planung – damit die sicherheitspolitischen Instrumente Deutschlands wirksam, zukunftsfähig und belastbar werden.
23. März 2025
Rolf Clement Journalist und ehemaliger Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk
Die in diesem Text geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung der gesamten Redaktion.

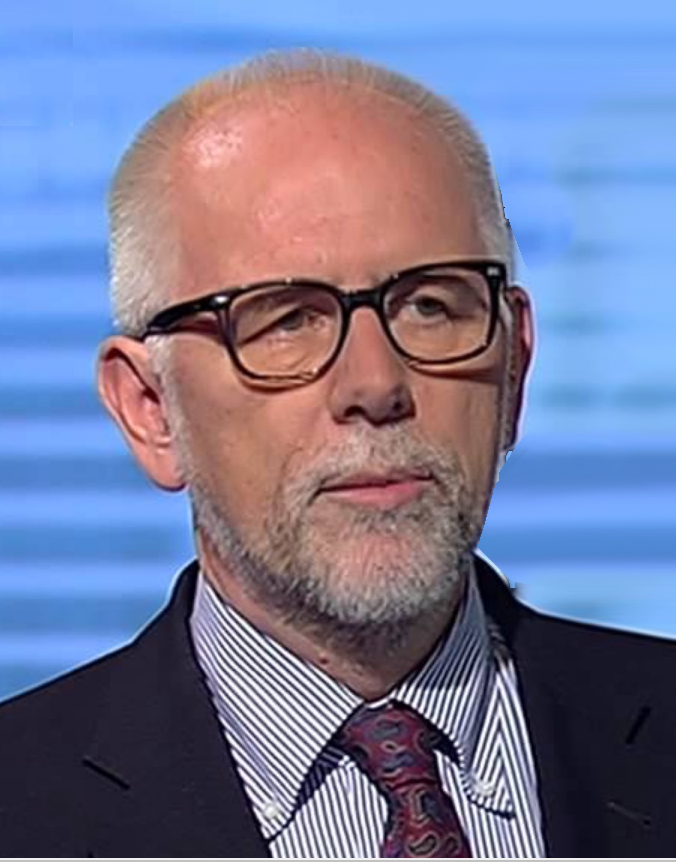
Schreibe einen Kommentar